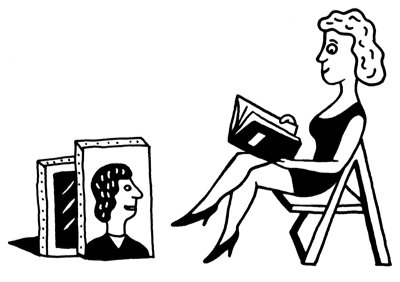Wie unterscheiden sich Grafik, Druckgrafik und Originalgrafik?
Mein lieber Freund und Kupferstecher!
Wenn fünf Menschen „Grafik“ sagen, können sie (mindestens) fünf verschiedene Dinge meinen und doch alle das richtige Wort verwenden. Grafik stammt vom griechischen graphiké und wird übersetzt mit „zeichnende/malende [Kunst]“. Etymologisch ist eine Grafik also erst einmal eine Handzeichnung. Das spiegelt sich auch in dem Begriff „Graphische Sammlung“ wieder für die Abteilungen von Museen, in denen sowohl Zeichnungen als auch Druckgrafiken aufbewahrt werden (und die früher „Kupferstichkabinette“ genannt wurden – ihren Namen also von einer druckgrafischen Gattung ableiteten).
In den letzten Jahrzehnten aber hat sich „Grafik“ als verkürzter Sammelbegriff für Original-Druckgrafiken, also Holzschnitt, Lithografie, Radierung usw. durchgesetzt. Neu hinzugekommen ist die Bezeichnung „Grafik“ für die Darstellung von Statistiken in einem Koordinatensystem und die „Computergrafik“ wie z.B. die Sichtbarmachung von Stimmgewinn- und -verlustdarstellungen bei Wahlen. In gewisser Weise werden auch da ja Sachverhalte zeichnerisch – grafisch – dargestellt.
Hier aber soll im Wesentlichen Aufschluss darüber gegeben werden, wie sich Grafik und Originalgrafik unterscheiden. Betrachtet man die Geschichte der Druckgrafik in Europa, so ist diese untrennbar mit der Verbreitung der Papierherstellung verbunden. Die im Vergleich zur Pergamentherstellung (aus Tierhäuten) wesentlich billigere und schnellere Produktion des Papiers begann auf deutschem Boden 1390, als die erste Papiermühle in der Nähe von Nürnberg entstand.
Der Einblattholzschnitt entstand um 1400 aufgrund einer wachsenden Nachfrage nach Andachtsbildern, die nicht mehr von malenden Mönchen gedeckt werden konnte. Nur knapp 50 Jahre später kam der Kupferstich hinzu – erfunden von Waffenschmieden, die ihre Ideen schicker Verzierungen, die sie in die metallenen Schwertscheiden der ritterlichen Kundschaft ritzten, durch Abdruck bewahren wollten. Künstlerisch führte Albrecht Dürer (1471–1528) sowohl den Holzschnitt als auch den Kupferstich zur Perfektion.
Dürer hat genau wie Tizian, Michelangelo und Raffael die Bedeutung der Druckgrafik auch darin gesehen, den eigenen künstlerischen Ruf zu verbreiten und über den Vertrieb der Blätter Einkünfte zu erzielen. So hat Dürer beispielsweise seine druckgrafischen Zyklen im eigenen Verlag verlegt und über den Buchhandel vertrieben. Hier handelte es sich um Originalgrafiken, denn der Künstler selbst hatte die Idee zu einem Bild und verfügte über die Fertigkeit, dieses in brillanter Form seitenverkehrt in eine Kupfer- oder Holzplatte zu stechen, zu ritzen, zu schneiden.
Daneben aber entstand ein ganz neuer, handwerklicher Beruf, der des Kupferstechers, der ohne eigene künstlerische Ambitionen über die Fähigkeit verfügte, ein bereits vorhandenes Bild „abzukupfern“, sprich ein vorhandenes Bild freihändig in eine zum Druck geeignete Kupferplatte zu übertragen. Diese Kupferstiche verbreiteten meist schwarzweiße Abbilder der Gemälde großer Künstler der Renaissance und des Barock in ganz Europa. Sie hatten die Funktion, die heute Bilder in der Zeitung haben. Sie sind Druckgrafiken, aber keine Originalgrafiken.
Dieses „Abkupfern“ hat durch die neuen Techniken der digitalen Bilderfassung und des rasterfreien Drucks aktuell Hochkonjunktur: Es ist ein lukratives Geschäftsmodell geworden, vorhandene Bilder zu reproduzieren, und durch Limitierung (Nummerierung) und Signatur den Eindruck von Originalgrafik zu erwecken. Warum haben die „Kupferstecher“ bis heute einen so zweifelhaften Ruf? Weil manch einer den künstlerischen Urheber, dessen Bild auf die Kupferplatte reproduziert wurde, verschwieg und den Druck als eigene Kreation ausgab (hier zur Vermeidung fälliger Lizenzgebühren).
Auch aktuell wird die Tatsache, dass es sich bei einem Gycléedruck oder Fine-art-print um die Reproduktion eines schon vorhandenen Bildes handelt, gern verschwiegen. Denn Reproduktionen müssten billiger sein, sie haben keinen Kunstmarktwert, und seien sie noch so „streng limitiert“ und signiert. Nicht die Technik, in der ein Bild hergestellt wird, entscheidet, ob es sich um ein Originalkunstwerk oder eine Reproduktion handelt, sondern die künstlerische Idee, die dann nur in der jeweils vorliegenden einmaligen Form existiert.
Deshalb finden Sie bei allen unseren Grafiken immer die Bezeichnung „Orig.-Radierung“ oder „Orig.-Lithografie“, denn auch alle klassischen grafischen Techniken könnten ohne Problem für Reproduktionen genutzt werden. Wir aber wollen nur künstlerische Originale.
Wolfgang Grätz