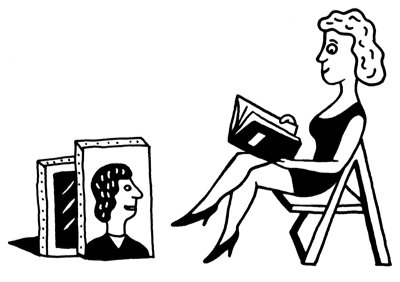Die 7 Leben des Hans Ticha
Dem Künstler zum 85. Geburtstag.
Geboren am 2. September 1940 noch unter der Naziterrorherrschaft im damals sudentendeutschen Tetschen-Bodenbach, verschlug es ihn als Sechsjährigen mit Mutter und Schwester ins das Städtchen Schkeuditz bei Leipzig in die sowjetische Besatzungszone, wo aus dem guten Willen vieler, ein besseres Deutschland zu errichten, schnell die antidemokratische Diktatur der SED wurde. 1990, kurz nach Öffnung der Mauer, verließ der nunmehr fast Fünfzigjährige, so schnell er konnte, die DDR, die ihn weder frei arbeiten noch ausstellen ließ, in Richtung Westdeutschland: Hans Ticha hat alle Katastrophen und Verwerfungen deutscher Staatlichkeit der letzten 85 Jahre am eigenen Leib erfahren. Und allen Widrigkeiten den eigenen unbeugsamen Willen zu seiner Kunst entgegengesetzt.
Der Sechsjährige, dessen Vater kriegsvermisst blieb, verbrachte seine freie Zeit als Schlüsselkind in der örtlichen Stadtbibliothek und las, was immer ihm in die Hände fiel. Daneben zeichnete und malte er von klein auf. Als eine Kinderzeitung eine frühe Zeichnung von ihm publizierte, nahm ihn ein ortansässiger Künstler unter seine Fittiche. Er wurde Mitglied eines Malzirkels, der auch Zeichnen in der Natur, Museums- und Ausstellungsbesuche organisierte. Nach dem Abitur absolvierte er zunächst ein Studium der Kunsterziehung und Geschichte und war nach dessen Abschluss tatsächlich auch zwei Jahre als Kunsterzieher tätig. Der obligatorische Militärdienst beendete diese erste Lebensphase, den Aufbruch zur Kunst.
1965 bewarb er sich um einen Studienplatz an der Kunsthochschule Berlin Weißensee und bekam einen der 6 (!) Plätze in der Malklasse. Das Studium war ein Slalomlauf zwischen regimetreuen Professoren und solchen, denen Ticha seine – nach DDR-Kriterien verpönten – formalistischen, konstruktivistischen Bilder zeigen und sich korrigieren lassen konnte. Hier wäre besonders Kurt Robbel zu erwähnen, der aber im System keine große Rolle spielte und auch nach der Maueröffnung keine Würdigung erlebte, während Arbeiten des ausgesprochen linientreuen Professors Walter Womacka, der das heute noch sicht-bare Mosaikfries am „Haus des Lehrers“ am Berliner Alex gestaltete, nach wie vor in Kunstauktionen auftauchen.
Schon in seinem letzten Studienjahr 1970 hatte Ticha Kontakt zu Zeitschriften- und Buchverlagen aufgenommen, seine Bücherfaszination aus der Kindheit versuchte er nun auch mit dem künstlerischen Broterwerb zu verbinden. Denn abhold westdeutscher Legenden über die staatlich alimentierte DDR-Kunst herrschte in diesem Metier eine für die DDR ungewöhnlich freie Marktwirtschaft: Besorg Dir Aufträge, dann verdienst Du Geld. Ticha probierte es auch mit Pressendrucken im Eigenverlag, aber ihn interessierte das massenhaft verbreitete Gebrauchsbuch mehr als die kleine handgefertigte Auflage. 1970 bekam er vom renommierten Verlag Ruetten & Löning seinen ersten großen Illustrationsauftrag, das Buch wurde sogleich auch als eines der „Schönsten Bücher des Jahres“ ausgezeichnet. Damit hatte er eine exzellente Visitenkarte für weitere Bewerbungen, und zum Ende der DDR 1990 weist sein Werkverzeichnis 71 illustrierte Bücher auf, 36 Illustrationsbeteiligungen und 64 Bucheinbände und Umschläge.
Die Buchillustration wurde erstaunlicherweise von der Zensur nicht sehr ernst genommen: „So erschien vor allem ab den 60er Jahren einiges an Umschlägen und Illustrationen, die sich an der klassischen Moderne orientierten, in Auflagen von mehreren Tausend; bei einer ähnlichen künstlerischen Haltung im Tafelbild, das in einer Ausstellung vielleicht gerade mal hundert Leute zu Ge-sicht bekamen, wäre es zu erbitterten Angriffen gekommen.“ schreibt Ticha. 20 seiner 71 Buchillustrationen in der DDR wurden im Wettbewerb „Die schönsten Bücher des Jahres“ ausgezeichnet, also mehr als jedes 4. Buch! Kunststudium und Etablierung als einer der bedeutendsten Buchillustratoren der DDR, das ist das zweite Leben des Künstlers.
Hans Ticha, der Maler. Knapp 500 Bilder Öl auf Leinwand führen die von Ticha akribsch editierten Werkverzeichnisse seiner Malerei von 1967 bis 1989 auf. Weitläufig orientiert an Fernand Leger und den russischen Konstruktivisten bilden sie anfangs Menschengruppen am Strand, Sport- und Alltagsszenen ab, in zeitloser Komposition, die Ticha in zahllosen Skizzen, Entwürfen und Aquarellen erkundet, bevor er die endgültige Form dann auf die große Leinwand bringt. Da er sich vom offiziellen Kunstbetrieb der DDR fernhält, ist er schon 36 Jahre alt, als er seine erste Einzelausstellung hat – in einem Berliner Kulturclub. In den 1980er-Jahren weist das Werkverzeichnis hauptsächlich Gemälde auf, die sich ironisch und satirisch über die Symboliken staatlicher Macht der DDR lustig machen. Ich habe mich immer gewundert, wie Ticha so viel Arbeit in großformatige Werke investieren konnte, von denen er nicht hoffen durfte, dass sie je eine Öffentlichkeit zu Gesicht bekommen würde, denn deren Entdeckung durch die Stasi hätte zu schweren Repressionen geführt. Auch so gab es Ermittlungsverfahren gegen den Künstler. Er sagt, dass er sie zur Selbstvergewisserung, für sich selbst gemalt hat. Ein Ventil, um die tägliche Schikanierung und Einschränkung der individuellen Freiheit zu ertragen. So aber kann er als der große Maler, der er ist, erst ab 1990 wahrgenommen werden.
Hans Ticha, der Vielseitige. Das bezieht sich auf: die plastischen Arbeiten, Assemblagen, Reliefs, Kunst im öffentlichen Raum, dazu unten mehr. Es geht um Schul-buchillustrationen, Gebrauchsgrafik und Werbung, der gegenüber er nie Berührungsängste hatte. Im Sinne des Bauhauses war für ihn die gute Form auch im Alltag von hohem Wert. Es gab zahlreiche Illustrationen für Zeitungen und Zeitschriften wie das Modejournal „Sibylle“. Er schuf Plakate für Verlage und Ausstellungen, wenn irgend möglich in originalgrafischer Form, verwöhnte Freunde und Künstlerkolleg/inn/en jährlich mit einer Neujahrsgrafik. Ja, natürlich auch die Druckgrafik! Was heute leicht aus dem Blick gerät: Druckgrafik braucht Bütten, braucht Druckfarben, braucht einen Drucker mit Presse oder Werkstatt. Braucht vor allem Ausstellungen zum Verkauf.
All das war in der DDR nicht selbstverständlich. Bis heute hortet Ticha schöne Büttenpapiere, aufgrund der DDR-Mangellage hegt er eine hohe Wertschätzung für jedes schöne Blatt Bütten. Deswegen gibt es bei seinen Auflagen immer auch Drucke auf den unterschiedlichsten Papieren, zum einen aus der Freude am Experiment, zum anderen aus Freude an der möglichen Vielfalt. Neben vielen Kleingrafiken schuf er 1969 bis 1989 fünfzig größere freie Druckgrafiken, einige davon sind noch erhältlich.
Als 1989 das SED-Regime zusammenbrach, war Ticha knapp 50 Jahre alt. Das gilt im Kunstmarkt als ein Alter, wo eine „Investition in eine Künstler-Marke“ nicht mehr lohnt. Ticha war relativ schnell nach der Maueröffnung nach Mainz umgezogen, wo ihn niemand kannte. Verbindungen zu westdeutschen Verlagen gab es natürlich nicht, und in der BRD wurden auch erheblich weniger Bücher illustriert als in der DDR. Im Siegesrausch der westdeutschen Übernahme und ignoranter Abwicklung aller Lebensleistungen, die in der DDR erbracht worden waren, schwangen sich Leute wie ein angeblich kopfstehend malender Mensch namens Baselitz dazu auf, alle Künstler, die im Gegensatz zu ihm in der DDR geblieben waren, als „Arschlöcher“ zu verunglimpfen (und, einen Atemzug später, alle Malerinnen als genuin unfähig...). Die Kunst der DDR wurde in Bausch und Bogen verdammt und in einer besonders niederträchtigen, von wenig namhaften westdeutschen Nichtspezialisten kuratierten „Show“ in Weimar 1999 in die Nähe von Nazikunst und Ramsch gerückt. Auch ein Bild Tichas wurde dazu missbraucht.
Wo bisher staatliche Repression seine Wahrnehmung als bedeutender Maler verhinderte, gab es nun eine gläserne Decke aus Marktmechanismen, Ignoranz und Platzhirsch-gehabe. Ticha malte 1991 das 2 x 1,50 m große Bild „Es wächst zusammen“, auf dem die Symbole des DDR-Staats mit Anzeigen für Reinigungsmittel, Pornos und, natürlich, Bananen verschränkt sind. Es kam durch Vermittlung des Büchergilde artclub zu einem sehr günstigen Preis an ein Mitglied der Büchergilde. Erst vor wenigen Jahren wurde es dann für 60.000 Euro inkl. Aufgeld und MwSt. in Berlin versteigert. Das fünfte Leben des Hans Ticha, das direkt nach der Vereinigung, war aber für ihn wie für die meisten in der DDR mutigen und widerständigen Künstler ein bitteres.
Wieder die Buchillustration! Während die Publikumsverlage der BRD bis auf wenige Ausnahmen auf Illustrationen verzichteten, gab es mit der Eremiten Presse und dem nach der Maueröffnung in Leipzig neu gegründeten Ver-lag Faber & Faber namhafte Akteure im Bereich der originalgrafischen Illustration, die Tichas Handschrift und grafische Fähigkeiten zu schätzen wussten. Und die Bücher-gilde beauftragte den Künstler 1995 mit der bildnerischen Ausstattung einer wuchtigen Ausgabe aller Ringelnatz-Gedichte, die Ticha, wie vorher schon die Gestaltung von Karel Čapeks „Der Krieg mit den Molchen“, zu einem Jahrhundertwerk machte. Auch verlegte er nun selbst Pressendrucke in kleiner Auflage. Tichas Illustrationen wurden vor allem für die Büchergilde zu Aushängeschildern ihrer Buchkunstbemühungen, es erschienen von ihm ausgestattete Bände mit Gedichten von Ernst Jandl, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Christian Morgenstern, Mascha Kaléko und Bertolt Brecht, eine Phalanx sondergleichen, und z.T. in der Technik der Orig.-Flachdruckgrafik illustriert. Auch wenn seit 1990 „nur“ noch 24 von Ticha illustrierte Bücher erschienen, verhalfen sie dem Künstler zu größerer Bekanntheit auch bei einem westdeutschen Publikum, das sich dadurch zunehmend für die Druckgrafik und die Malerei Tichas zu interessieren begann.
Ich gestehe, ich liebe Happy Ends. Hier ist eines: das siebte Leben des Hans Ticha. In dem es nun doch noch zur Anerkennung einer außergewöhnlichen Kunst und einer außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit durch Feuilletons, Galerien und Museen kommt. Offenbar bedurfte es einer neuen Generation von Museumsleuten und Journalisten, die mit unverstelltem Blick etwa ab 2015 begannen, Tichas Arbeit zu schätzen, auszustellen und anzukaufen. Eine Berliner Galerie vertrat nunmehr engagiert die Malerei Tichas auf dem Kunstmarkt, die Nationalgalerie kaufte Bilder von Ticha an, die Zeitschrift „art“ entdeckte ihn auch „wieder“ (???), die Preise für seine Bilder auf Auktionen namhafter Häuser stiegen in fünfstellige Höhen. 2022 wurde er für sein Gesamtwerk des illustrierten Kinder- und Jugendbuches mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. 2025 publizierte die „Zeit“ Tichas Arbeit würdigende Artikel von Florian Illies und Tobias Timm (dem Sohn des Schriftstellers Uwe Timm), der schreibt: „Ticha ist der wichtigste noch lebende DDR-Künstler“. Ja, genau, schon lange.
Eine weitere Wertschätzung erfuhr Ticha durch die Tatsache, dass eine von ihm 1979 am Schulspeisungsgebäude in Berlin Marzahn geschaffene plastische Wand-gestaltung mit freistehender Betonplastik 2018 aufwändig restauriert wurde, und hier kommen wir zu der Frage, was ich Ihnen nach unzähligen Ausstellungen mit den Arbeiten des Künstlers seit 1992 noch Neues bieten kann. Nun, die Antwort lautet: wunderbar leuchtend-farbige Aquarelle Tichas mit den Vorzeichnungen für ebenjene Plastiken. Dieses Bau-Kunstwerk ist in der Franz-Stenzer-Straße 39 in Berlin Marzahn jederzeit öffentlich zugänglich.
Wolfgang Grätz, September 2025